In dieser Kolumne wird unser Redakteur Tyll Leyh erwachsen. Das ist zumindest der Plan. Er probiert Hobbys, scheitert und liefert dabei Einblicke in sein Seelenleben. Diese Woche ist alles sehr optimistisch, gerade weil einem manches noch erspart bleibt.
Langsam werden die Maßnahmen gelockert. Es gibt endlich wieder mehr Ablenkung und Abwechslung. Die Cafés öffnen wieder, wenn auch nur für Menschen mit Schwimmnudeln auf dem Kopf, aber immerhin muss nicht mehr nur alleine getrunken werden und sicher steigt bald endlich wieder die Kriminalitätsrate. Die Welt dreht sich wieder weiter, während sie sich öffnet.
Die Quarantäne hatte wenige gute Seiten. Einiges verschwand im Kontaktverbot. Fußball zum Beispiel, oder nervige Verwandte besuchen und auf der Fahrt dorthin im Stau oder in überfüllten U-Bahnen stehen. Aber sehr kluge Menschen dürfen nun wieder einem Ball hinterherlaufen, Verwandte dürfen angehustet werden, und der Verkehr ist auch wieder zurück. Nichts ist besser geworden, einiges anders.
Das Einzige, das noch fehlt, um gänzlich zur „Normalität“ – was auch immer das sein mag – zurückzukehren, ist die Kultur. Scheinbar entbehrlich, nie wichtig und wohl zumindest mit sehr schlechter Lobby. Dabei vermisse ich volle Abende, verschwitzte Momente, Euphorie und Enttäuschungen. Eben Emotionen, das Leben kanalisiert in 2 Stunden Ablenkung und Unterhaltung.
Es gibt nur eine Sache, die gerne für immer in der kulturellen Versenkung verschwunden bleiben darf, die bitte nicht wiederkommen soll: Die eine Sache, die noch schlimmer ist als Comedy.
Pest, Cholera, Poetry-Slam.
Es geht um jene Ausgeburt der Germanistenhölle, in der nachdenkliche Studis, die leider die Bolognareform nicht verkraftet haben, mal so richtig über ihre Gefühle reden dürfen, während sie Texte vorlesen, die ungefähr so relevant sind, wie die Bilder kleiner Kinder am Kühlschrank.
Was ist Poetry-Slam überhaupt?
Die Idee war, eine Alternative zum etablierten Literaturbetrieb zu sein, jung, subversiv und bewusst ein jugendliches Publikum ohne Literaturkenntnisse ansprechend. Junge Autor*innen tragen dabei nacheinander, für einen Abend, ihre meist unpublizierten Texte vor. Unveröffentlicht, weil die Qualität der Texte leider auch nur höchstens für einen Abend erträglich ist und es gut tut, das Erlebte dann wieder vergessen zu dürfen und nicht auch noch schriftlich daran erinnert zu werden. Zum Glück geht ein Auftritt nicht länger als 10 Minuten und meist bestimmt die Länge und Lautstärke des Applauses über den Gewinner.
Jeder Gesellschaft die Kunstform, die sie verdient (falls von Kunst gesprochen werden kann)
Poetry-Slams sind Abende für Selbstdarsteller und Anspruchslose, offen für jeden zu früh gescheiterten Lebenskrisler, der Gefallen daran finden kann, sich einem banalen Publikum anzubiedern.
Und genau darin liegt das Problem von Poetry-Slam. Alles ist dermaßen ausgelegt auf Publikumswirksamkeit und schlechte Pointen, dass es gar nicht erst zu jenem disruptiven Element kommen kann, das den Slam sonst vom Literaturbetrieb abheben würde. Stattdessen steht immer der Wiedererkennungswert im Mittelpunkt. Also bestimmen gewollte popkulturelle Verweise zu Netflixserien, Sentimentalitäten, Binsenweisheiten auf dem Niveau von Kalendersprüchen die vorgetragenen Texte.
Schlimmer als Akkustikgitarren
Es ist nie gut, sich von seinem Publikum abhängig zu machen, erst recht nicht, wenn man überraschen möchte. Zwangsläufig wird dadurch alles konform und zersetzt von Stereotypen und unsäglichen Maximen. Der*die Zuschauer*in will ja aktiviert werden, ein kollektives Erlebnis und bitte die direkte Verständlichkeit des Vorgetragenen, Anschaulichkeit, Rhythmus und Appelle an gemeinsame Überzeugungen. Das führt dann dazu, dass sich die*der Vortragende genötigt fühlt, bestimmte stereotype Rollen einzunehmen und für 5 Minuten Tankwart zu spielen. Fürs soziale Gefälle. Das kann nicht funktionieren. Als Währung dieser unerträglichen Veranstaltung dient dann der Applaus, oder noch schlimmer, die Applausrakete:
Erst klatschen, dann trampeln, dann Gejohle und am besten gleich nach Hause.
Kein sozialer oder politischer Protest, wie zum Beispiel beim Poetry-Slam in Frankreich, keine durchbrochenen Grenzen für sozial schwächere Schichten, nur ein Haufen Mittelschichtskinder, die sich über das Schlangestehen im Supermarkt aufregen.
Wieso verwandelt sich alles, was im deutsprachigen Raum ankommt und interessant sein könnte, immer nach und nach zu etwas Unerträglichem. Gekapert von halbgaren Akademikern, die so konform sind, dass sie gar nicht merken, wie sie Langeweile und Sättigung aus jeder ihrer verschwitzten Hoody-Poren ausatmen. So Vollgestopft mit so vielen vererbten Zwängen, dass nur die langweiligste und banalste Version von allem, was da hätte sein können, übrig bleibt.
Poetry-Slam, bleib einfach weg.
Nächstes Mal geht das Leben dann also wieder wirklich weiter, und meine lebensweltlichen Probleme stehen endlich wieder im Mittelpunkt. Es folgt: Tyll tut #15 – umziehen.
Wertung entfällt.
Ich weiß auch nicht, wie man das schreibt.





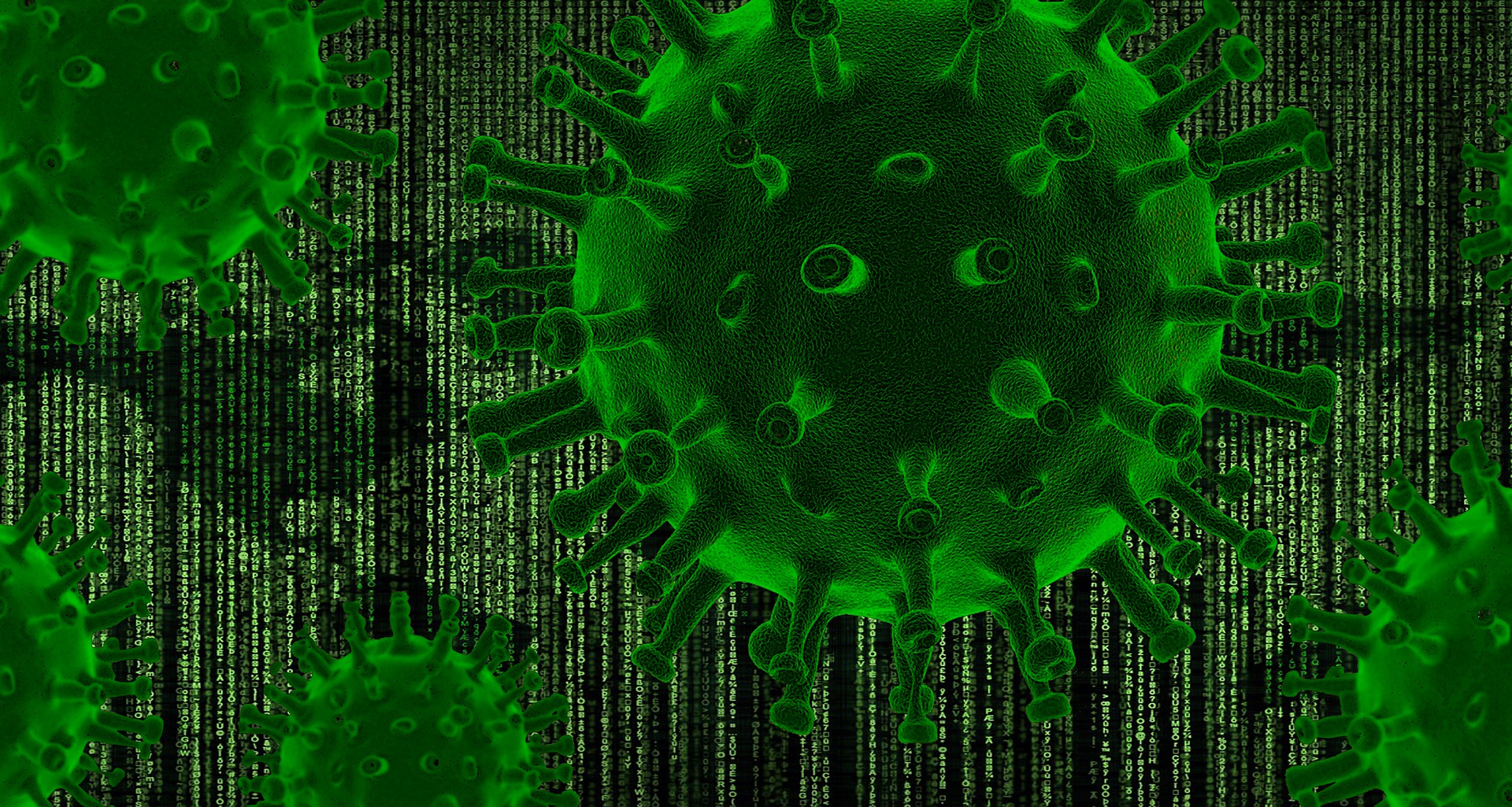

Dankesehr