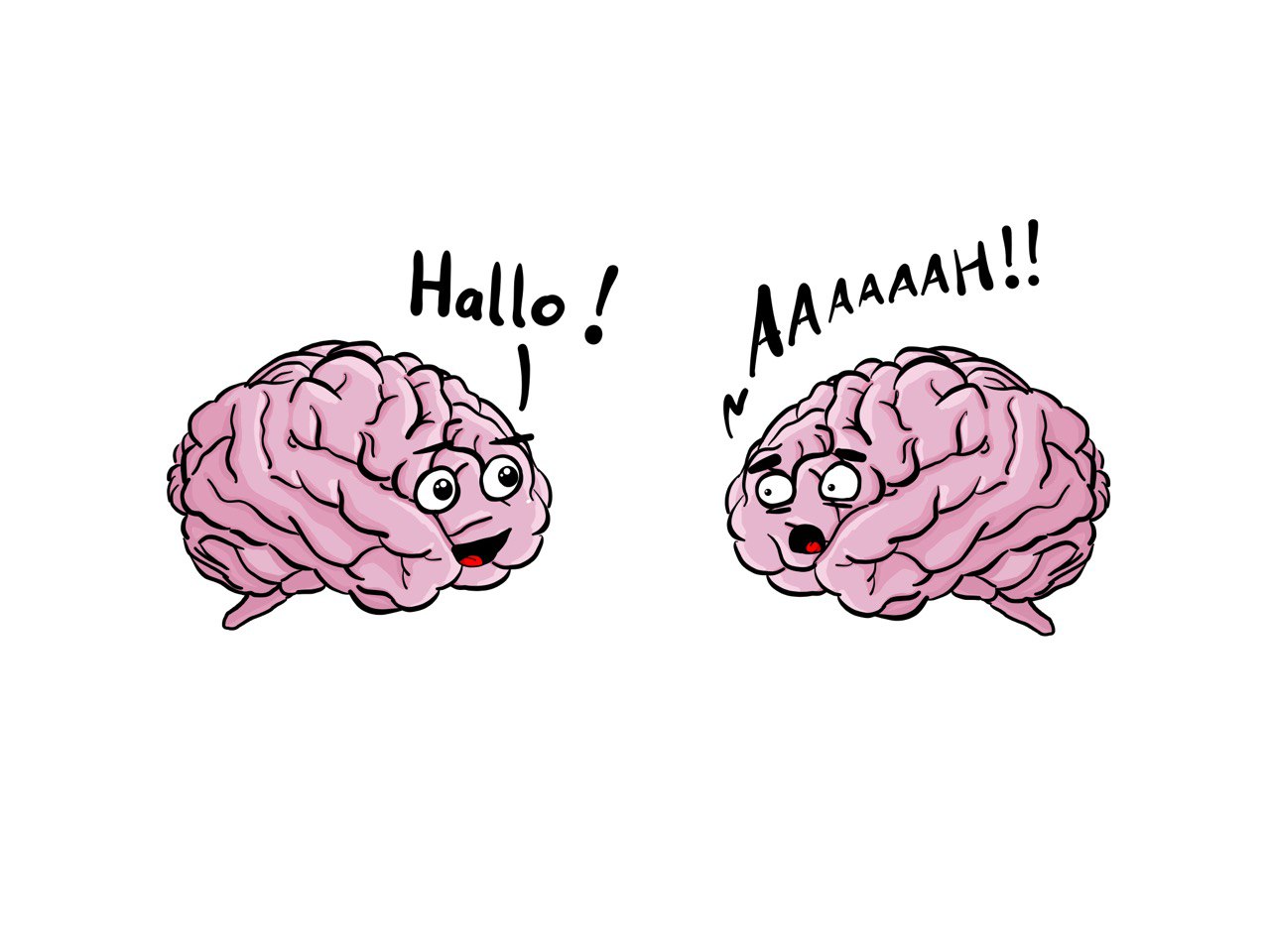Mehr als ein Jahr war das social life auf Eis gelegt. Ein Babyelefant Abstand, auch zu den Freund*innen, die man sonst so gern umarmt. Immer in der Wohnung, Freitagabende im Videochat verbringen. Nicht nur die Laune und die Emotionen gingen in den Keller, auch andere Hirnareale leiden unter sozialer Isolation. Aber warum, nach all dem Träumen von Partys, Umarmungen und Gesprächen mit geliebten Menschen, stresst der Gedanke daran, sich wieder in die Wogen des Socialisings zu stürzen?
Für die einen war die Verkündung des ersten Lockdowns schon eine Hiobsbotschaft, andere genossen die unvorhergesehene Pause von sozialen Pflichten. Ein Jahr später sehnt man sich danach, zur Begrüßung den Ellbogen der besten Freundin zu berühren und das Gespräch nicht mit: “Ich glaub du bist stumm geschalten” beginnen zu lassen.
Der Mensch ist darauf angewiesen, in Gemeinschaft zu leben. Das Gehirn ist darauf programmiert, sich in Gruppen zurechtzufinden und reagiert auf Isolation mit Angst und Stress. Evolutionstechnisch war dieser Mechanismus absolut wertvoll: Wer von der Gruppe getrennt wurde, hatte eine erhöhte Cortisolausschüttung – der Blutdruck stieg, damit die Blutversorgung im Gehirn und es wurde mehr Glukose produziert. Diese gab Energie und der Herumirrende konnte konzentriert und energiegeladen zu seinen Gefährten zurückfinden.
Schrumpfende Hippocampi
Was passiert aber, wenn die Isolation von längerer Dauer ist? Im Gehirn gibt es zwei Strukturen, die ein wenig wie Seepferdchen aussehen, genannt Hippocampi. Sie sind für die Speicherung von Gedächtnisinhalten zuständig. Daten aus dem Kurzzeitgedächtnis werden hier in das Langzeitgedächtnis (sozusagen das Archiv) übertragen. Je öfter zwei Nervenzellen (Neuronen) gleichzeitig aktiviert werden, desto stärker wird die Verbindung zwischen ihnen. Außerdem werden im Hippocampus neue Neuronen gebildet und in die vorhandenen Strukturen eingebaut.
Befindet man sich über längere Zeit in einer monotonen Umgebung (beispielsweise immer in der gleichen Wohnung) und ist sozial isoliert (oder sieht immer nur seine Mitbewohner*innen), werden die Nervenzellen weniger gebraucht – es werden keine neuen Verknüpfungen geschaffen und die schon vorhandenen müssen weniger aktiviert werden, weil sich das Hirn nicht auf Umgebung und Menschen einstellen muss. Die Folge ist, dass die Hippocampi an Volumen verlieren und so auch weniger neue Neuronen produziert werden.
Social Cravings
Wie Nahrung brauchen wir auch soziale Interaktionen. Haben wir Hunger, bekommen wir ein Verlangen nach Essen, das Motivationszentrum im Gehirn springt an, um uns zu einer Aktion zu bewegen – wir machen uns auf die Suche um den Hunger zu stillen. Eine Studie untersuchte die Gehirnaktivität von Menschen, die entweder zehn Stunden nichts aßen oder sozial isoliert waren, das heißt weder Kontakt zu anderen noch Stimuli wie soziale Medien, Filme oder Bücher hatten. Bei beiden Situationen sprang das Motivationszentrum im Gehirn an, beim Fasten wollte es dazu bewegen, Essen zu suchen, bei der sozialen Isolation verlangte es nach Kontakten.
Einen ähnlichen Effekt kann man bei Träumen beobachten: Die häufigsten Themen bei Träumen während der Lockdowns und vor allem danach waren “geliebte Menschen” (“loved ones”) und “belebte Orte” (“crowded places”), wie eine italienische Studie untersuchte.
Mehr Freiheit, mehr Stress
Als es dann endlich Lockerungen gab, kam auch der Stress. Eine Befragung zeigte, dass fast die Hälfte der US-Amerikaner sich unwohl bei dem Gedanken daran fühlt, sich wieder mit anderen Menschen zu treffen, unabhängig davon, ob die Beteiligten schon geimpft sind oder nicht.
Eine Studie mit Marmosetten-Äffchen, die eine Zeit lang isoliert waren und dann wieder resozialisiert wurden, fand erhöhte Stress- und Cortisolwerte im Blut der Äffchen. Diese sanken nach kurzem aber wieder ab und die Äffchen genossen die Gesellschaft.
In den letzten eineinhalb Jahren haben sich unsere Gehirne darauf eingestellt, mit weniger sozialen Kontakten auszukommen, beziehungsweise mehr digital zu interagieren. Es wird ein wenig dauern, bis diese Einstellungen wieder zurück auf Pre-Corona gesetzt sind.
Langsam zurück zur Zivilisation
Wichtig ist, Geduld und Verständnis für diese Gefühle aufzubringen, auch wenn es vielleicht unverständlich erscheint, warum man vor den Treffen mit Freund*innen so unruhig und gestresst ist, wo man doch früher bei diesen Menschen am besten abschalten konnte.
Auch von Freizeitaktivitäten braucht man Pausen. Das Gehirn muss alle Eindrücke verarbeiten und dazu erst mal den Staub von den alten neuronalen Verbindungen pusten. Was dabei helfen kann, ist sich hinzusetzen und seine Gedanken aufzuschreiben oder etwas zu machen, bei dem man nebenbei gut nachdenken kann, beispielsweise zeichnen, stricken oder auch staubsaugen.
Lassen wir es langsam angehen und geben unserem Hirn Zeit, es hat die letzten eineinhalb Jahre genug durchgemacht.
Titelbild: (c) August Hammel
Studium der Astrophysik. Psychotherapeut*in to be.