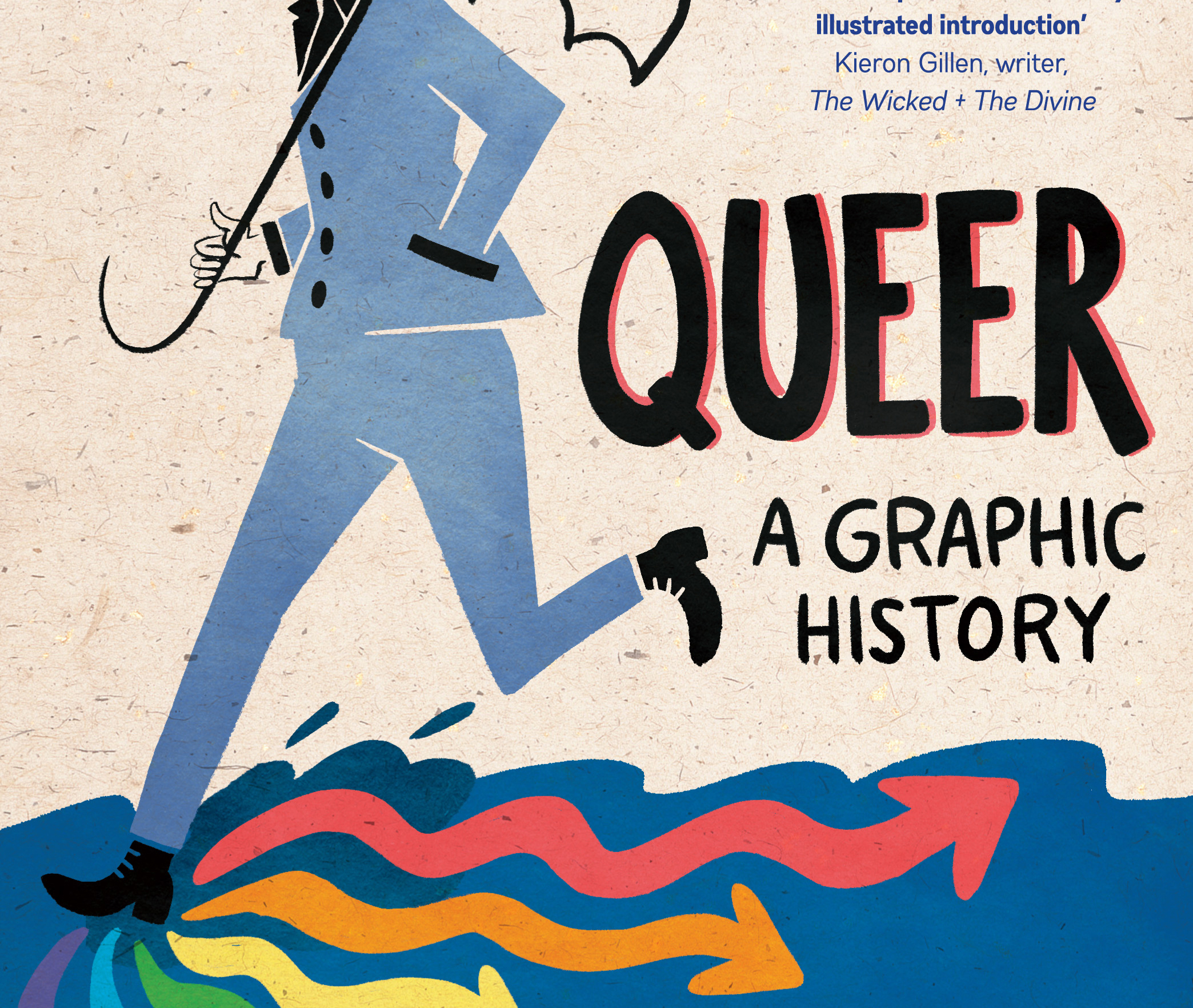Hillary Clinton hätte die erste weibliche Präsidentin der Vereinigten Staaten werden können. Drei Jahre nach ihrer Wahlniederlage fallen noch immer viele auf ihre feministische Selbstinszenierung herein. Warum es Zeit ist, ihrem falschen Feminismus keinen Glauben mehr zu schenken.
Auch ich war während des US-Präsidentschaftswahlkampfes 2016 eine von jenen Feminist*innen, die Hillary Clinton für den Inbegriff der Frauenrechtsbewegung hielten und alle die widersprachen, wenn auch aus guten Gründen, als Sexist*innen abstempelten. Knapp drei Jahre benötigte ich, um zu realisieren, dass eine Frau in einer Machtposition nicht notwendigerweise einen Sieg für den Feminismus darstellt, schon gar nicht, wenn diese mit ihrer Politik anderen Frauen schadet.
Hillary Clinton hat es, trotz jahrelanger frauenfeindlicher Politik geschafft, ihre feministische Reputation zu halten; tatsächlich scheint es in ihrem Fall auszureichen, eine Frau zu sein, um als Frauenrechts-Ikone zu gelten. Dass Clinton durch ihre Unterstützung von diversen Kriegen feministische Bewegungen in diesen Ländern unterminiert hat und zu gesellschaftlicher Instabilität beigetragen hat, die vor allem für Frauen und Minderheiten verheerend ist, oder als langjähriges Vorstandsmitglied von Walmart Niedriglöhne und aggressives Verhalten gegenüber Gewerkschaften tolerierte, schien dieses Image nicht trüben zu können. Auch ihre Unterstützung und Lobby-Arbeit für ihren Mann Bill Clinton, als dieser 1996 einen Kahlschlag im Sozialsystem durchführte, der unter anderem für alleinerziehende Mütter fatale Konsequenzen hatte, schaffte es Hillary Clinton als unabhängigkeitsfördernde, ja sogar feministische Maßnahme zu verkaufen.
Feminismus sollte nach Umbruch streben
Natürlich ist es erfreulich, dass Clinton eine befürwortende Position gegenüber Abtreibung einnimmt, sich gegen sexuelle Gewalt äußert oder mittlerweile auch endlich die Ehe für Alle unterstützt. Aber Feminismus lässt sich nicht auf diese Themen reduzieren. Feminismus sollte nach einem grundlegenden Wandel und Umbruch der gesellschaftlichen Verhältnisse streben und bestehende soziale Konstrukte aufbrechen. Daran hat Hillary Clinton kein Interesse: Sie will Macht innerhalb des Systems, ohne dabei anzuerkennen, dass dieses auf Ungerechtigkeit und Diskriminierung anderer beruht. Das Establishment, von dem Clinton ihre gesamte politische Karriere profitiert hat, macht sie dann nach der Wahl zum Grund ihres Scheiterns. „Ich denke, es ist zum Teil, weil ich eine Frau bin“, schreibt sie in ihrem 2017 erschienen Buch What Happened über ihre Niederlage. Ein solches Verständnis von Feminismus, bei dem sich mächtige, privilegierte Frauen unangreifbar machen wollen, macht diesen schlichtweg unglaubwürdig.
Ihr wahres Gesicht zeigte Clinton, als sie vor kurzem über ihren Parteikollegen Bernie Sanders in einem Interview sagte: „Niemand mag ihn, niemand will mit ihm zusammenarbeiten, er hat nichts hinbekommen“. Verwunderlich ist dies nicht, tritt Sanders schließlich für eine kostenlose Gesundheitsvorsorge, eine Abschaffung der Studiengebühren, eine höhere Besteuerung der Reichen und einen Mindestlohn von 15 Dollar ein – Maßnahmen, von den Frauen besonders profitieren würden, da diese in den USA, wie in fast allen Ländern der Welt, überdurchschnittlich stark von Armut betroffen sind. Damit repräsentiert Sanders genau jenen antikapitalistischen, feministischen Zeitgeist, den Clinton ihre gesamte politische Karriere zu bekämpfen versucht hat.